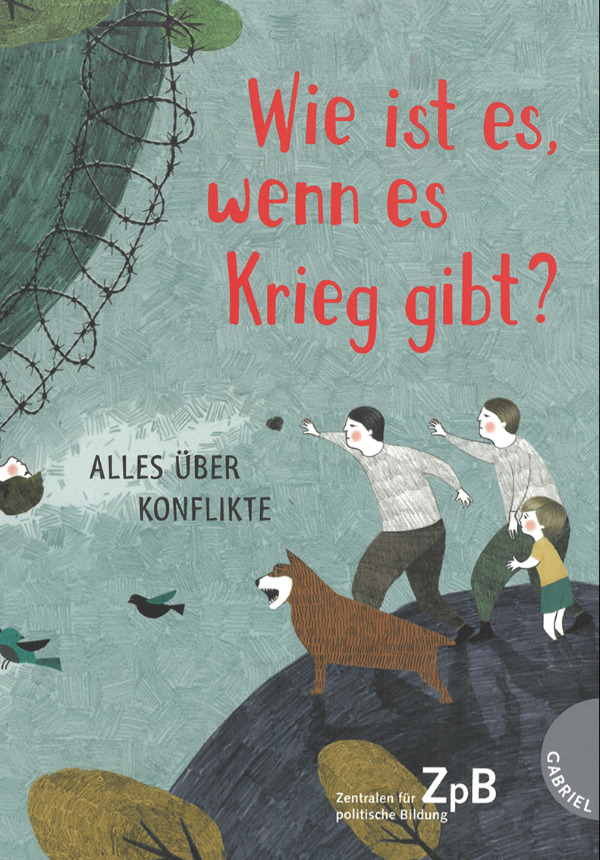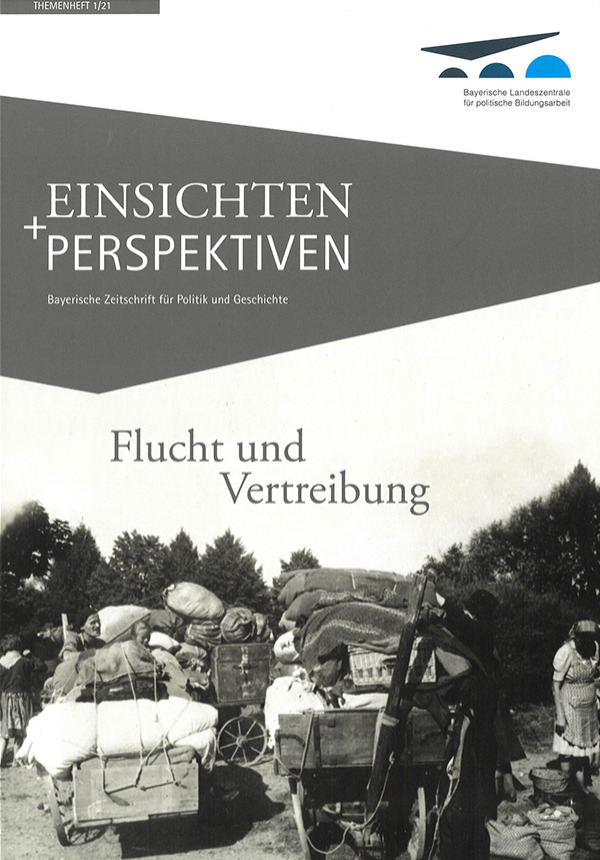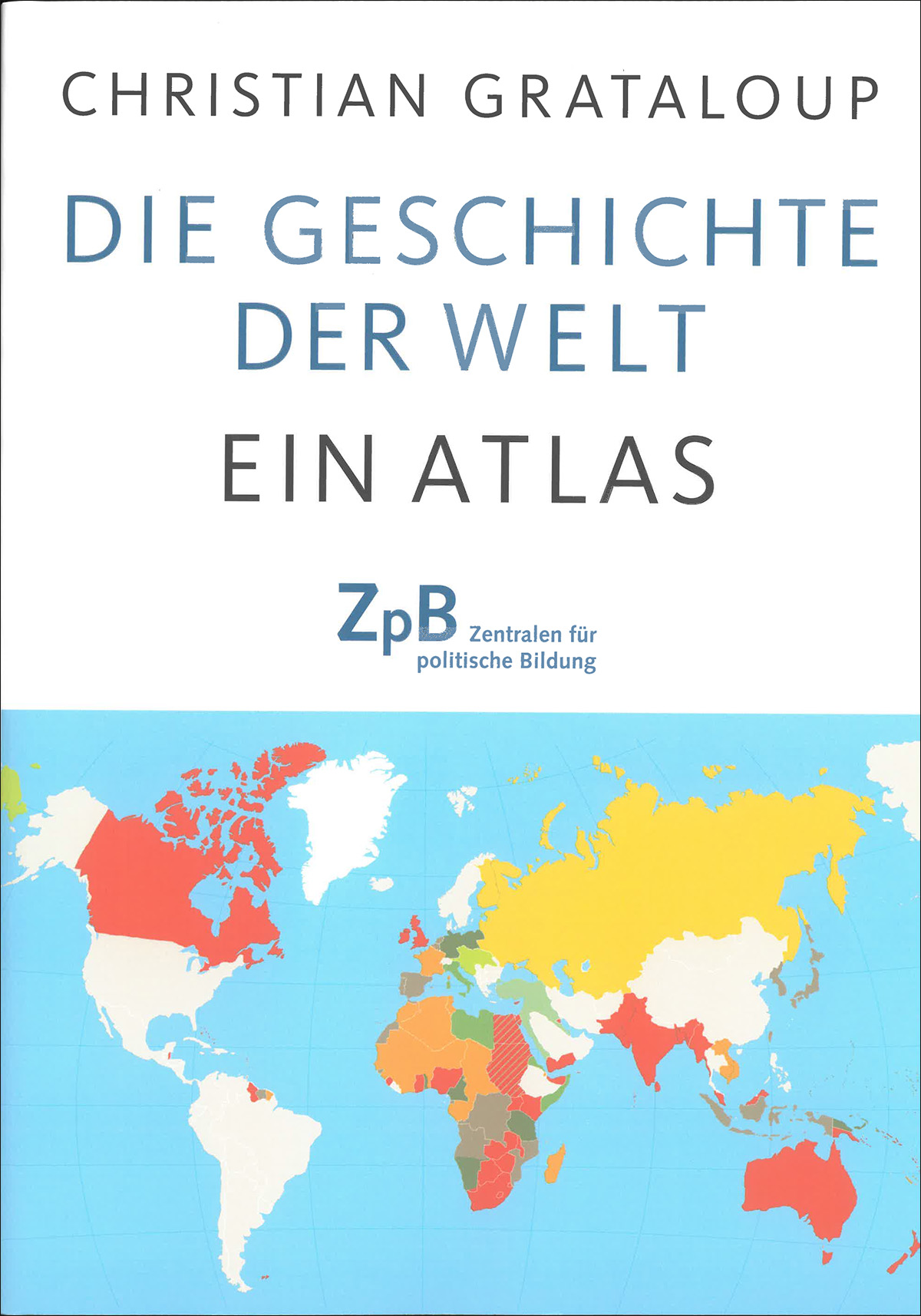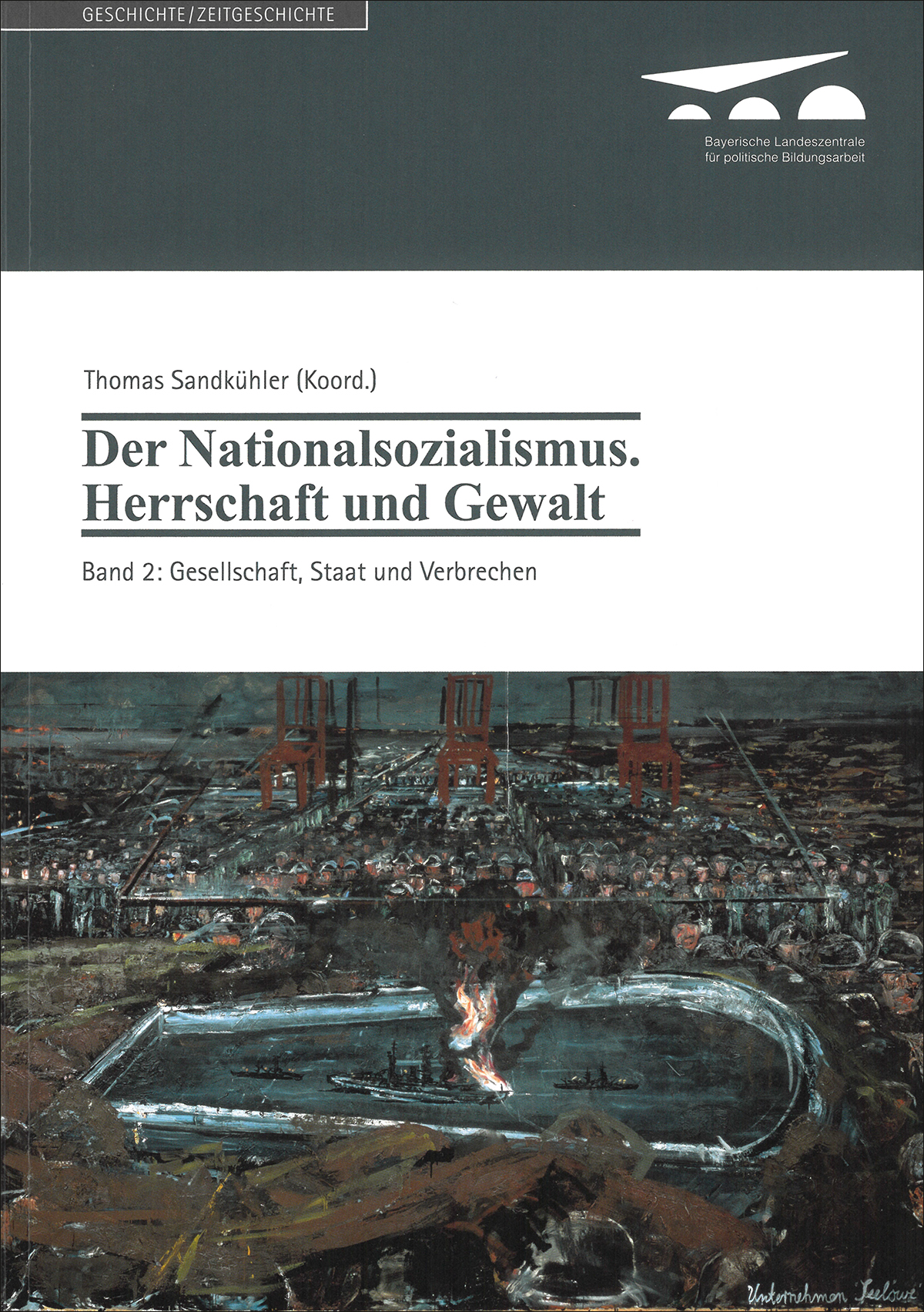1945-2025: 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg
- Themen
- 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg
Am 6. Juni 1944, dem sog. D-Day , landeten alliierte Truppen in der Normandie. Damit wurde das Ende des NS-Regimes eingeläutet, das die Welt mit dem Überfall auf Polen im September 1939 in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs gestürzt hatte.
Während die Westalliierten von Frankreich und Italien aus vorstießen, rückte die Rote Armee auf die deutschen Ostgrenzen vor.
Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht schließlich bedingungslos. Der Zweite Weltkrieg hatte über 60 Mio. Menschenleben gekostet.
Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenstellung der Angebote der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit zu diesem Thema. Diese Angebote werden laufend erweitert.
Während die Westalliierten von Frankreich und Italien aus vorstießen, rückte die Rote Armee auf die deutschen Ostgrenzen vor.
Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht schließlich bedingungslos. Der Zweite Weltkrieg hatte über 60 Mio. Menschenleben gekostet.
Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenstellung der Angebote der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit zu diesem Thema. Diese Angebote werden laufend erweitert.
Digitale Formate

Zeit für Politik: Unterrichtsstunde zu 80 Jahren Kriegsende
Die Unterrichtsstunde behandelt folgende Kernfragen:Wie erlebten die Menschen in Deutschland das Kriegsende 1945?
Warum war (und ist) die Bezeichnung „Tag der Befreiung“ umstritten?
Sollte der 8. Mai bundesweit gesetzlicher Feiertag werden?
Sie benötigen für diese Stunde:
Ausdruck des Arbeitsmaterials (1 Exemplar oder alternativ in der Anzahl der Schülerinnen und Schüler)
Klebeband oder Magnete zum Aufhängen der Bilder
Ausdrucke des Arbeitsblatts (Klassenstärke)
Am 8. Mai 1945 unterzeichneten hochrangige Militärs des Deutschen Reiches die bedingungslose Kapitulation. Dies gilt als offizielles Ende des Zweiten Weltkriegs, den Deutschland begonnen hatte und der schätzungsweise über 60 Millionen Opfer forderte. Mit dem Krieg endete auch die brutale Diktatur, die Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten in Deutschland errichtet hatten. Jährlich finden am 8. Mai deutschlandweit Gedenkveranstaltungen statt.
80 Jahre nach dem Kriegsende wird noch darüber debattiert, ob der 8. Mai als zusätzlicher Feiertag daran erinnern kann, dass ein friedliches Zusammenleben keine Selbstverständlichkeit ist. Der Historiker Martin Sabrow schlug z.B. 2020 vor, den 8. Mai als „Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges“ bundesweit zum gesetzlichen Feiertag zu machen. Andere Historikerinnen und Historiker sind skeptisch. Der Berliner Senat beschloss Mitte 2023 einen Gesetzesentwurf, um einmalig den 8. Mai 2025 in Berlin (wie auch schon den 8. Mai 2020) zum gesetzlichen Feiertag zu erklären.
Alle Informationen und Materialen finden sich hier.
Veranstaltungen

Fackelzüge – Springerstiefel – TikTok-Channel. Deutschlands radikale Rechte von 1945 bis 2025
Hunderttausende Menschen demonstrierten im Februar 2025 gegen Rechtsextremismus – zeitgleich werden die Gedenkfeiern an die Befreiung nationalsozialistischer Konzentrationslager und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 80 Jahren vorbereitet. Nach 1945 wähnten viele in West- und Ostdeutschland den Nationalsozialismus überwunden. Doch sie irrten. Während in der Deutschen Demokratischen Republik das antifaschistische Selbstverständnis den Blick auf fortbestehende Einstellungen verstellte, meinte die Bundesrepublik als streitbare und wehrhafte Demokratie gegenüber den neu gegründeten rechtsradikalen Parteien, Jugend- und Traditionsverbänden, Kulturgemeinschaften und Publikationen gewappnet zu sein.
Doch weder Parteiverbote noch zivilgesellschaftliche Proteste gegen Ewiggestrige und junge Neonazis verhinderten, dass die radikale Rechte und die Auseinandersetzung mit ihr dieses Land bis heute prägen. Doch wie und warum? Und kann angesichts der Unterschiede zwischen dem Auftreten heutiger junger Rechtsextremer auf der Videoplattform TikTok, den Fackelmärschen rechtsradikaler Gruppierungen in der frühen Bundesrepublik und den Skinheads mit klobigen Stiefeln der 1990er-Jahre tatsächlich von einer rechtsradikalen Kontinuität seit 1945 gesprochen werden?
Es diskutieren:
PD Dr. Franka Maubach, Universität Bielefeld
Prof. Dr. Gideon Botsch, Moses Mendelssohn Zentrum, Potsdam
Prof. Dr. Andreas Wirsching, Institut für Zeitgeschichte München–Berlin
Moderation:
Dr. Martin Langebach, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn
Prof. Dr. Martina Steber, Institut für Zeitgeschichte München–Berlin
Eine Kooperation von
Bayerische Akademie der Wissenschaften
Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit
Bundeszentrale für politische Bildung
Institut für Zeitgeschichte München–Berlin
Der Stream kann hier angesehen werden: badw.de